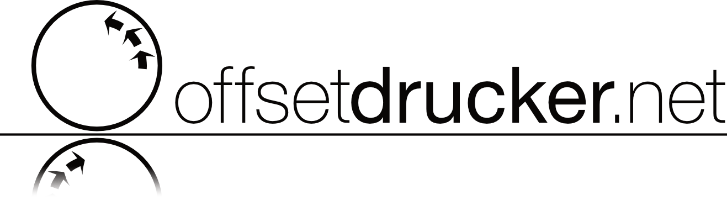Manche Fachleute sehen als Emulsion nur den Zustand an, den sie aus Störungen kennen. Das ist durchaus nicht einfach nur dumm. Wenn man das Medium unter dem Mikroskop betrachtet, das gerade verdruckt wird, sieht man keineswegs zwei klar abgegrenzten Substanzen. Die Fogra hat hierzu an ihrer Labor-Heatset-Maschine Aufnahmen gemacht und publiziert.
Allerdings ist es so ein Problem, zu sagen, dass man auch den wirklichen Zustand in flagranti erfassen kann. Sobald man auch nur kurz anhält, ordnet sich alles schnell um. Aber auch Aufnahmen mit einer Hochgeschwindigkeitskamera sind schwierig durchzuführen.
Hier haben wir mal ein Beispiel, das zeigt, wie man sich helfen kann. Wenn die Beobachtungen der Praxis und von Laborexperimenten nicht alle zusammenpassen, macht man sich ein Gedankenmodell, eine Hypothese. Und die ist dann brauchbar, wenn alle bisherigen Beobachtungen hinein passen. Das ist also ein Hilfsmodell, keine reine Wahrheit.
So etwas hat Vorteile, solange man damit Dinge erklären und regeln kann, die in der alten Vorstellung nicht verständlich sind. Sollten aber neuere Erkenntnisse dazu kommen, die nun nicht mehr passen, muss man sein Modell verfeinern. Oder man braucht sogar ein komplett neues. Die Wissenschaften leben mit solchen Verfahren sehr erfolgreich. Unsere Technik ist so kompliziert, dass bildhafte Vorstellungen und „das, was wir sehen“, nicht immer weiter helfen.
Physikalisch gesprochen gehen wir von zwei Phasensystemen aus, der Wasser-in-Öl - Emulsion und einer Öl-in-Wasser-Emulsion. Definitiv haben wir noch die andere, im einfachen Fall, rein wässrige Phase vor uns, die mit arbeitet.
So lange nur so wenige Wassertröpfchen in die Farbe ein-emulgiert werden, dass die Sache sich nach außen als Farbe zu erkennen gibt und vernünftig durch die Maschine transferiert wird, läuft unser Offsetprozess. Auf der Platte entsteht eine gewisse Tonwertzunahme durch Überfärben der Druckflächen, aber alles im erwarteten und berechenbaren Rahmen.
Diese Emulsion spaltet zwischen den Walzen fast 50/50 und „fließt“ glatt durch das Farbwerk. Sie verteilt sich aufgrund der erniedrigten Zügigkeit deutlich glatter als eine reine Farbe, siehe Aufliegen bei Buchdruck oder wasserlosem Offset.
Zwingen wir mehr Wasser hinein, verliert die Sache so an Zügigkeit und wird höher viskos („butterig“). Dann spaltet sie schlechter, kann „pelzen“, sich z. B. an den Walzenkanten ansammeln - und dann in Placken davon geschleudert werden. Hier passt das Modell „Öl-in-Wasser - Emulsion“.
Es hilft leider nichts, hier den Ausdruck „Emulgat“ für die böse Variante zu wählen. Sprachlich ist jedes Emulgat auch eine Emulsion, für uns also zwei völlig gleichwertige Wörter.
Es gibt auch Fachleute, die zwischen einem „Binnenwasser“ und einem „Außenwasser“ unterscheiden. Das eine sind die ein-emulgierten Tröpfchen, das andere das eigentliche Feuchtmittel. Für die Offsetpraxis habe ich hieran noch keinen besonderen Nutzen gefunden. Es ist immerhin von fachlichem Interesse bei bestimmten Messtechniken, mit denen man den Zustand des Wassers beschreiben will (Thermoanalysen).