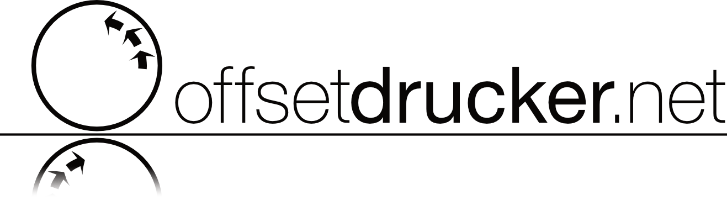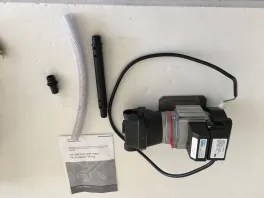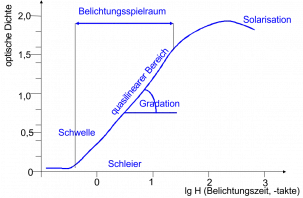Die Ursprünge unserer modernen Messtechnik liegen
in den Anwendungen und Bedürfnissen des Buchdruckes, denke ich. An
seinen Druckmaschinen konnte man zonal die Farbschichtdicke auf
den Walzen regeln und brauchte dafür eine griffige Messgröße.
Die
optische Wirkung einer bedruckten Fläche liegt in der
Lichtabsorption. Versuchen wir es also mal mit der Absorption.
Ohne
Einfärbung ist sie gleich Null, mit mehr und mehr Farbe steigt sie.
Das ist schon besser als bei der Remission, denn die ist ohne Farbe
am höchsten und sinkt bei sehr, sehr dicker Farbschicht auf Null.
Aber
wenn wir die Absorption mal quantitativ (mengenorientiert)
betrachten, sieht es wieder wenig praktisch aus. Der Grund ist
einfach im Modell mehrerer einzelner Farbschichten übereinander zu
zeigen: Nehmen wir an, die erste Schicht schwächt das Licht auf die
Hälfte. Die zweite Schicht schwächt diese wieder auf ihre Hälfte,
also um ein Viertel der ursprünglichen Stärke. Das geht so weiter,
ein Achtel, ein Sechzehntel usw.
Praktisch
wäre ein Maß, das bei der doppelten Farbschicht auch einen -
wenigstens ungefähr - doppelten Messwert zeigt. Damit wären wir
beim Vorschlag der optischen Dichte, der aus der Vorstufe mit
fotografischen Filmen als Maß für Schwärzung bekannt war. Man
musste sie nur auf klare Wellenlängenbereiche definieren, damit man
Cyan, Magenta und Yellow einzeln erfassen konnte. Dafür die Farbfilter.
Außerdem
haben wir ja Auflicht - Verhältnisse. Da interessiert uns wenig, wie
viel die Lampe denn abgibt, das I0 vom Durchlicht. Wir
hätten lieber einen Vergleich mit dem, was eine Blanko-Fläche
zurückwirft. Das wäre unser „100%“. Wir brauchen also aus aus
dem Techniker-Vokabular einen „Remissiongrad“ (s. a. Quizfrage
198):
Lichtströme zurückgegeben
IDruck vom Druck
Iblanko vom Blankopapier
Weil ich es gerade nicht besser kann, schreibe ich hier "Beta" für den griechischen kleinen Buchstaben, den man üblicherweise hier nimmt.
Remissionsgrad
Beta = IDruck
/ Iblanko
Wir
übernehmen die optische Dichte mit dem Logarithmus des
Transmissionsgrades und ersetzen ihn durch unseren technischen
Remissionsgrad.
optische
Dichte im Druck
D = - log Beta = log ( Iblanko / IDruck
)
Das
ergibt eine Kurve, die bei IDruck = Iblanko von
0 startet (Logarithmus von 1), ziemlich gerade (quasilinear) ansteigt
und erst in höheren Bereichen (über 5) mit der Krümmung beginnt.
Interessant
ist noch, dass die optische Dichte eine reine Logarithmenzahl ist,
also keine Dimension wie m, sec oder g hat.
(s.
a. Frage 127: Wellenlängen bei opt. Dichte)