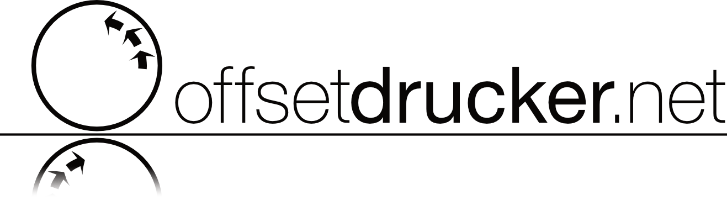Hallo Dexter,
danke für die nette Aufforderung. Ich habe mich absichtlich erst
zurückhalten wollen, um den Praktikern von euch genügend Raum zu
lassen. Aber ich antworte gerne, natürlich.
Hallo Jonny85,
ich wollte mich nicht gleich einmischen, weil ich doch die Sachen
mehr labormäßig betrachte und Drucker an der Maschine manchmal
Beobachtungen haben, die der Theorie zu widersprechen scheinen - und
nicht immer waren die bisher falsch. Wenn etwas nicht erklärlich
ist, fehlen meist Informationen.
1. Du:"Einer der Drucker meinte letztens zu mir, dass beim
Drucken OHNE Dispersionslack, er den Infrarot-Strahler an lässt,
damit der Bogen schneller trocknet."
Das ist definitiv nicht zutreffend. Früher, ohne Lackierwerke,
wurde IR gerade eingeführt. um die Verfestigung abzusichern und zu
beschleunigen. Man muss den Befund also näher untersuchen und
herauskriegen, was er wirklich damit meint.
2. Du:"Als ich früher an meiner Speedmaster Infrarot mal aus
Versehen vergessen habe auszumachen und unlackiert gedruckt habe, hat
es immer lange gedauert, bis es getrocknet ist und teilweise haben
auch Bogen abgelegt."
Auch hier fehlt eine Information, wenn die Beobachtung stimmen
sollte. Ohne Dispersionslack dauert es immer viel länger, weil der
als Schutzschicht mit seiner schnellen Verfestigung den noch
klebrigen druck schützt. Sollte es abgelegt haben, und sollte das
ohne IR weniger passieren, ist die Stapeltemperatur zu hoch geraten.
Damit steigt die Klebrigkeit der Drucke. Auch IR nützt nur, wenn es
kontrolliert eingesetzt wird.
3.Du:"Dass IR-Farben schneller trocknen mit Infrarot ist mir
ja klar, aber wie sieht es denn mit normalen Farben aus?
Trocknen normale Farben mit IR besser oder nicht? Denn meine
Erfahrung ist bis heute eher letzteres."
Die Bezeichnung "IR-Farben" ist eine reine Werbeaussage.
Es gibt keine auch nur einer Strahlenhärtung ähnlichen
Farbkonstruktion, die auf IR reagiert. Es gibt nur besonders schnell
wegschlagende Farben, bei denen die Erwärmung durch IR sich
deutlicher bemerkbar macht als bei fetten, langsamen - z. B.
Folienfarben. Und die modernen Farben sind immer weiter darauf
gezüchtet worden, schnell ihren Verdünner weitgehend an das Papier
abzugeben und damit klebfrei zu werden. Das wird werblich als
Besonderheit benutzt - schon seit Generationen, um Produkte
aufzuwerten. Eine UV-Farbe ist eine ganz andere Sache, arbeitet nicht
nur bei kürzeren Wellenlängen.
4. Was dein Druckmeister da erzählt hat, ist entweder
missverstanden - oder laienhafte Erklärung ohne Kenntnisse der
Sache. Es ist durchaus möglich, dass er so etwas gesagt hat. In der
"Fachliteratur" und auch manchmal in ernsthaften
Lehrbüchern steht eine Menge zusammengereimter Quatsch. Besonders
betroffen sind hier Platte und Farbe. Ich habe mir in der Ausbildung
von Studenten ganz besondere Mühe mit den Lehramtsstudenten gegeben,
weil die ihr Wissen ja weitertragen. Bei denen habe ich euch durch
die Bank Engagement und Neigung zu naturwissenschaftlichem Denken
gefunden.
Falls du nähere Informationen gebrauchen willst, schaue mal in
die Quizfragen hier:
Frage
4, Farbentrocknung
Kann
man einen vollständig weggeschlagenen Druck als „trocken“
bezeichnen?
Frage
45, Trocknung von Dispersionslacken
Lack-,
Farb- und Klebersysteme, die wässrig aufgebaut sind, bezeichnen wir
in unserer Fachwelt als Dispersionen. Sie haben mehrere Arten der
Trocknung und Verfestigung. Die einfachste betrifft das Wasser: Wie
trocknen sie?
Frage
116, Trocknungsaggregate 1
Wozu
dient die IR – Strahlung und wozu die Heißluft in einer
Bogenoffset - Druckmaschine bei der Trocknung von Druckfarben und
Dispersionslacken?
Frage
117, Trocknungsaggregate 2
Wo
liegt der Unterschied zwischen den Trocknungsmechanismen von IR- und
UV- Strahlung?
Frage
262, Gibt es im Bogenoffset Farben, die mit Wärme trocknen?
Frage
285, Wasser kann Lösemittel bzw. die Flüssigkeit in Druckfarben und
-lacken sein. An welchen Trocknungsmechanismen nimmt es teil?
Das
war zwar schon viel Text. Aber ich habe schnell geantwortet, um nicht
den Eindruck zu erwecken, es gehe mich nichts an. Eine klare
Beschreibung dieser Trocknungsvorgänge und ihre Wirkungen mach ich
noch. Aber das dauert ein, zwei Tage, weil mir gerne Zeit lasse, um
einen Text auf Verständlichkeit und Korrektheit zu prüfen.
Viele
Grüße & ciao
Euer
Inkman