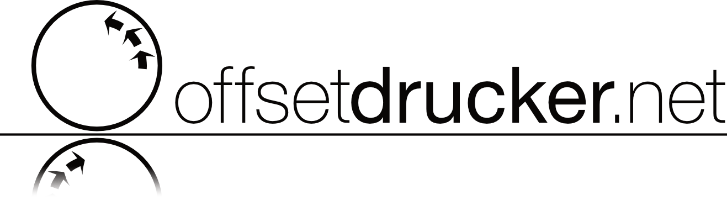Diese Frage ist gar nicht so klar, wie
sie klingt. Sie ist in der Art naiv wie die alte Frage kleiner Jungen
nach dem schnellsten Auto der Welt, also nicht fachmännisch.
So
viel zu dem Quatschsatz, es gebe keine dummen Fragen, nur dumme
Antworten.
Eine
absolute Scheuerfestigkeit ist nicht einmal mit einem UV - Lack zu
erreichen.
In
der Praxis treten immer mal wieder rettungslos überzogene Forderungen
auf, z. B. 500 oder 1000 Hübe mit dem Prüfbau Quartant (Beispiel
Zigarettenverpackungen).
So
etwas simuliert nicht einfach die praktischen Anforderungen nur
härter. Sobald während des Scheuertests eine erste Beschädigung
auftritt, kratzen die abgesprungenen Lackpartikel kräftig mit - und
intensivieren dadurch deutlich den Scheuerangriff. Es ist dabei egal,
ob der Beginn in einer lokalen Schwäche lag oder ein zufällig
anwesendes Staubkorn war.
Wenn
plausible Beanspruchungen einen Druck akzeptieren lassen, die
Messpraxis aber dennoch Schwächen zeigt, fehlt es meist an der
gründlichen Beobachtung. Manche mechanischen Beanspruchungen wirken
auch unter erhöhter Feuchtigkeit oder Temperatur ganz anders als
üblich. Dann ist es ein Kunstfehler, einfach unter Normalbedingungen
im Labor die Zahl der Scheuerhübe maßlos zu erhöhen: Es wurde der
falsche Wirkungsmechanismus erwischt.
In
vielen Lieferanten - Kunden - Verhältnissen dominiert noch immer
eher die Machtfrage. Und die Einsicht, dass dadurch am Ende für
beide unnötige Kosten entstehen, haben wir zwar alle leicht in der
Prinzipiendiskussion. Wir wenden sie nur nicht auf den Fall von
heute an.
Fachmännisch
lässt sich die Frage beantworten, wenn man für ein Druckprodukt den
bestimmungsgemäßen Gebrauch nimmt und zwischen Drucker und Abnehmer
eine realistische Spezifikation vereinbart. Die und die dazu nötigen
Prüfungen können sehr unterschiedlich sein. Vergleichen wir mal
eine Tageszeitung und eine Verpackung für Geschirr.
Und
wenn das - wie üblich - nicht extra vereinbart worden ist? Dann, ja
dann wird verhandelt. Und wenn jemand dabei seine Marktmacht zu stark
ausspielt, ist er schlicht unfachmännisch.
Dann ist das eben Geschäft.