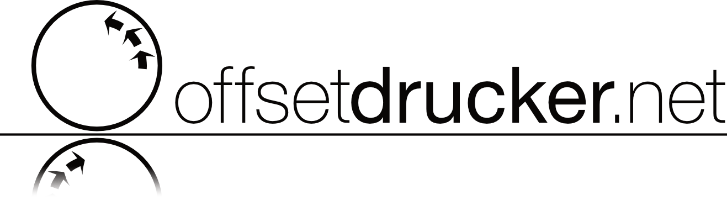1. Eine glänzende Oberfläche reflektiert das Licht gerichtet, sie spiegelt. Also betrachten wir sie nicht gerade im Blendwinkel der Beleuchtung, sondern schräg. Der Farbeindruck ist in diesem Zustand kräftig und bunt bzw. tief.
In der Trocknung, und auch in der oxidativen Verfilmung, schrumpft der Farbfilm und bekommt eine raue Oberfläche. Mindestens rauer als zuvor, auch bei Glanzfarben. Die diffuse Reflexion der Beleuchtung lässt sich nicht ausixen. Also haben wir einen weißlichen Schimmer drauf, der Farben weniger bunt macht und Schwarz vergraut. So flau wird der Druck verkauft, wenn er nicht veredelt wird. Immerhin bleibt ja wenigstens der Farbton erhalten.
2. Der zweite Effekt ist schon tückischer. Er verändert die Druckoberfläche meist über eine längere Zeit, also Minuten bis halbe Stunden. Auch durch Schrumpfen des Bindemittels werden die Pigmentteilchen an der Oberfläche näher zusammengebracht, also aufkonzentriert. Und in besonders starken Fällen nehmen wir dann einen farbigen Schimmer, eine Reflexion wahr, die anders gefärbt ist, als wir es von diesem Pigment gewöhnt sind. Genau besehen, hat sie sogar die komplementäre Färbung, also die Färbung, die eigentlich absorbiert werden sollte, damit ein Blau auch ein Blau ist. So kommt ein orangeroter Schimmer dazu.
Na, wenn das nicht stört!
Viele Fachleute bewerten nur die Gesamtwirkung und meinen, der Druck hätte seinen Farbton geändert. Na ja, er hat etwas dazu bekommen, wenn man es genau besieht. Und da dieser Schimmer etwas metallisch wirkt, haben unsere Vorväter das „Bronzieren“ genannt, ein Schimmer wie von Bronze. Wir erleben das praktisch nur bei intensiven Blaus. So hat unsere Fachwelt es bis 2009 gesehen und auch ernsthaft und tiefgründig damit experimentiert.
Ein Student der Druck- und Medientechnik in Wuppertal, Matthias Prinzmeier, ist der Sache mal ganz unbefangen wissenschaftlich auf den Grund gegangen und hat ganz unterschiedliche Pigmentierungen auf weißem und auch auf schwarzem Untergrund untersucht. Und dabei zeigte sich, dass die Erscheinung gar nicht auf Blaus und Violetts begrenzt ist. Und er hat auch eine seriöse physikalische Erklärung erarbeitet. Wer ein bisschen Physik im Text verkraftet, kann hier Näheres erfahren. Zwei Beispiele im Anhang.
Übrigens, zur Vollständigkeit: Das andere Bronzieren spreche ich kommende Woche an.
3, Es gibt noch einen dritten Grund zur Farbtondrift im Wegschlagen. Auch ohne den Anteil der Bronze verändern sich besonders sehr bunte, farbintensive Drucke oft erheblich. Dieser Teil geht nicht durch eine nachfolgende Lackierung wieder weg. Und er unterscheidet sich bei einer Farbe deutlich mit dem Wechsel des Bedruckstoffes.
Ich habe einmal einen Vergleich gemacht mit lauter glänzend gestrichenen Papieren. Sie wurden im Hochdruck (Prüfbau) bedruckt und jeweils gleichgewichtige ausgewählt, also solche mit gleicher Farbschichtdicke. Sie wurden farbmetrisch vermessen - frisch, weggeschlagen und lackiert. Die Farben waren lasierend. Also haben wir den Unterschied der Papiere im Farbort vom Ergebnis abgezogen. Und trotzdem blieben noch bis zu 8 Delta-E-Einheiten Unterschied, für die wir keine Erklärung fanden.
Einen klaren Grund haben wir damals nicht experimentell bestätigen können. Unsere Arbeitshypothese war, dass es Ordnungsvorgänge je nach Saugverhalten und Porenverteilung der Papieroberfläche waren. So ist sie eine Hypothese geblieben.
Und was kann man machen?
Die Probleme 1 und 2 sind weg, sobald eine transparente Schicht oben drauf liegt, also Lack oder Folienkaschierung (Hq_seppel hat Recht). Somit kennen alle Drucker mit in line Lackierung beide nicht in ihrer Praxis. Der noch unaufgeklärte Effekt der Papieroberfläche bleibt so als Rest. Wenn er mal wirkliche eine störende Rolle spielen sollte, ist guter Rat teuer. Denn auch der Papierhersteller kann ihn nicht verhüten: Er weiß ja auch nicht näher, was hier das Karnickel ist. Immerhin scheint es kein großes Problem zu sein. Man hört sonst nichts darüber.