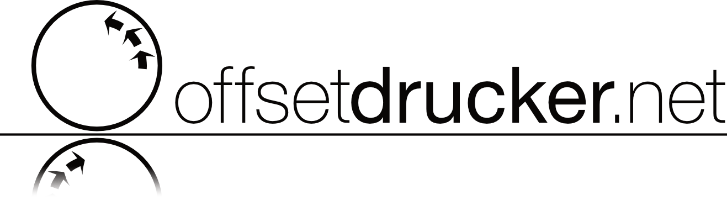Hallo Schubbeduster,
na klar hast du recht. Mal abgesehen von einem glatteren und
weißeren Papier kann man auf viele Weisen hier eingreifen.
Ein feinerer Raster hat mehr Grenzlinie zwischen bedruckten und
unbedruckten Partien. Damit führt er zu erhöhtem Lichtfang und ermöglicht damit
zusätzliche, reinere Farbtöne. Das kann ein 12Oer anstelle des 80er Rasters
sein. Die meisten oder alle FM-Raster sind ebenfalls Feinraster. Damit kommen
sicher auch alle Hybridraster (ha ha ha, s. letzte Quizfrage) infrage.
Verändern wir die Buntfarben im Skalensatz,
ergeben sich deutliche Zugewinne. Das kann schon durch stärkere Pigmentierung
der drei Skalenbuntfarben sein:
Nova Space von
K&E (jetzt SUN),
Aniva von Epple,
hicos von Huber,
high end von Sun und
high body von Jännicke & Schneemann.
Es gibt auch den Zusatz weiterer Buntfarben und zusätzlich
Umpigmentierung bei
Heidelberg,
Hexachrome von Pantone,
FMsix von M.Y.PrinTech
in NL,
Opaltone aus USA,
ederMCS von eder,
spotless von Kodak,
MIPP von Pantone zusammen mit Eckart-Werke,
FMsix,
ecp von Huber und
Krysalid von Sicpa.
Die Liste ist schon ein bisschen alt, und nicht alle werden
überlebt haben. Wahrscheinlich gibt es auch noch weitere wie das von Küppers
mit 7 Farben, das das UCR-System nutzte. Mit Sicherheit hat sich auch schon
Brunner mit so etwas beschäftigt.
Im Feinbau verbessert ein Farbe-Papier-Kombi ebenfalls, wenn es
signifikant niedrigere Tonwertzunahmen bringt. Damit ist u. a. auch der
wasserlose Offsetdruck abgesprochen.
Theoretisch gibt der Tiefdruck mit geätzter Form auch den
Farbenraum besser wieder, weil er tiefenvariabel ist und die reineren Farbtöne erreicht, die
wir durch unsere Flächenvariabilität schlachten.
Mal sehen, wem noch etwas einfällt; das Thema kann viel
hergeben. Ob es wirtschaftlich etwas bringt, ist oft sicher sehr unsicher. Ich
erinnere mich, dass es einmal Mode war, japanische Skalenfarben einzusetzen, weil
die die kalten Töne zwischen Cyan und
Magenta reiner brachten als unsere europäischen. Das ist verschwunden. In
unserem Kulturbereich sind warme Töne um das Rot herum für die Werbung viel wichtiger
als Violetts.
Übrigens profitieren beileibe nicht alle Druckarbeiten von
diesen „Hi Fi“ – Systemen. Bei wenig Farbabnahme gibt es eher Emulgiertests als
brillante Ergebnisse.
Viele Grüße & ciao
Inkman