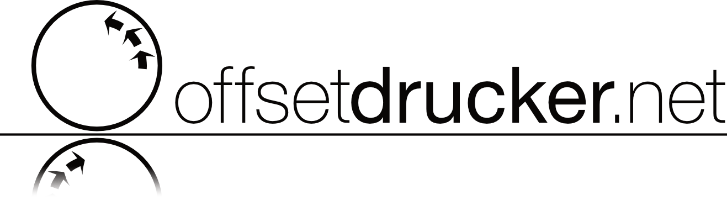Meine Antwort:
Spoiler anzeigen
Bei periodischen Rastern wachsen die Punkte mit der Flächendeckung und kommen sich an den Ecken immer näher. Wenn zwischen Rasterpunkten sehr geringe Abstände auftreten, werden sie auf der Platte von Farbe überbrückt. Störungen von Rasterverläufen und Sprünge in der Druckkennlinie sind die Folge. Beispiel "Punktschluss im Raster".jpg
Quadratische Punkte kommen alle bei 50% aneinander. Damit spielt sich dieser Punktzuwachs gleichzeitig bei allen Rasterpunkten ab, und seine Störwirkung ist deutlich. Kreise haben dieses Problem bei 66 %. Zur Verbesserung hat man fotografisch Ellipsen als Rasterpunkte eingesetzt und damit den Störeffekt halbiert – in einer Richtung bei 33 %, in der senkrecht dazu liegenden bei 66 %.
Die Gründe für den Punktschluss können vielseitig sein. Unser Offsetdruck hat hier ein eigenes Problem, besonders der konventionelle Offset mit Feuchtmitteln (s. a. Frage 62).
Solange wir bei periodischen Rastern bleiben, können wir nur an der Punktform etwas machen. Immerhin geben die modernen Bebilderungsverfahren mit Pixeln vielfältige, neue Möglichkeiten. Man kann Defekte in die Punkte einbauen, etwa abgeknabberte Ecken. Oder die Punktform je nach Flächendeckungsbereich ändern. Oder ganz pfiffig, die Punkte so raffiniert formen, dass sie sich fast bis in die letzten Werte hinauf nicht berühren wie beispielsweise bei Sandy P.