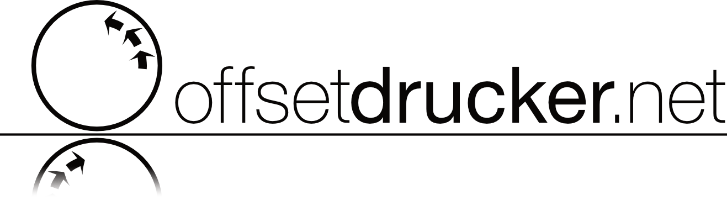Hallo
Schubbeduster,
die
"Werte" für unsere Skalenfarben bestimmt heutzutage ein
Normenausschuss, der auf europäischer Ebene arbeitet. Der baut dann
ISO-Normen. Und danach können die EU-Mitgliedsländer sie in eigene
nationale Normen überführen, bei uns als DIN ISO Norm. In diese
europäischen Normenausschüsse schicken die einzelnen nationalen
Normenausschüsse auch ihre Abgeordneten - in Wirklichkeit, um
eventuelle Interessen der eigenen Industrien angemessen
berücksichtigt zu sehen.
Wir
sind damit einverstanden, sie so zu benutzen, weil wir damit
zuverlässig untereinander spezifizieren können, wie ein
Vierfarbdruck erledigt werden muss - und wir gegebenenfalls
Reklamationen begründen oder ablehnen können.
Normen
sind ein ganz interessantes Kapitel; darüber habe ich schon einen
eigenen Beitrag geplant.
Kurz
gesagt, kann eine Industrie, die aus vielen kleinen, mittleren und
großen Partnern besteht, Normen gebrauchen, damit jeder eine
vereinbarte Grundlage hat. Gibt es nur wenige große Player, macht
jeder Laden sein Ding und verpflichtet seine Lieferanten zu
entsprechenden Leistungen. So kenne ich noch aus dem
Illustrationsdruck Skalenfarben mit - für uns - abenteuerlichen
Pigmenten. Da spielte eben der Preis eine größere Rolle, und Axel
Springer oder Burda redeten direkt mit ihren Farblieferanten. Und
sagten ihnen direkt, was zu tun sei. Sie nannten es auch Blau und
Rot...
Der
gute alte Buchdruck muss es gewesen sein, der auf eine richtige
Organisation der drei Buntfarben aus war. 1954 wurde nämlich schon
die erste deutsche Norm aufgestellt, die DIN 16509, später auch
"kalte DIN-Skala" genannt. Sie wurde 1967 gründlich neu
erarbeitet mit leicht veränderten Farbtönen, Pigmenten besserer
Echtheiten und als DIN 16539 zur "Europaskala" gemacht.
Ich
war damals noch nicht im Gewerbe, schätze aber, dass unsere FOGRA,
möglicherweise auch die UGRA in der Schweiz, hier die treibenden
Kräfte waren. Ich kann mich an meine ersten Jahre drin (ab 1985)
erinnern, dass auf allen Kongressen die FOGRA fast nervte mit der
"Standardisierung im Offsetdruck". Segensreich, weil sich
in anderen Ländern nicht wirklich Entsprechendes entwickelte. Der
Entwicklungsstand der deutschen Druckindustrie und ihrer Zulieferer
war eben weltweit führend.
1997
wurde dann - mit immer besser international abgestimmten
Geschäftsbeziehungen - die weltweit gültige, derzeit aktuelle Norm
ISO 2846-1 aus
der Taufe gehoben. Ursprünglich hatte man sich in Europa umgehört
und eine Harmonisierung organisiert. Dann wollte man auch den Rest
der Welt überreden und hat immerhin eine Art Kompromiss mit der
SWOP-Skala formuliert als Endzustand. Das war in USA die einzige
Norm; sie galt für den Rollenoffset. Und soweit ich es wahrnahm,
hatte man danach gehofft, dass der Rest der Welt sich einordnete. Es
scheint funktioniert zu haben. Sicher weil eben ein sehr gründlich
erarbeitetes und außerordentlich gut durchorganisiertes Normwesen
Vorteile für alle zeigte.
Es
gab durchaus Unterschiede, z. B. zur JapanColourSF90. Und inzwischen
gibt es auch Normen für andere Druckverfahren. Ich wäre neugierig
zu sehen, wie sich da unsere Hersteller von Digitaldruckmaschinen
verhalten. Bisher durchschaue ich da wenig. Ich habe nur den
Eindruck, dass jeder gute Drucke verspricht, aber eine
wissenschaftliche Beschreibung gar nicht will. Vermutlich verteidigt
man immer Alleinstellungsmerkmale, solange es geht.
Viele
Grüße & ciao
Inkman