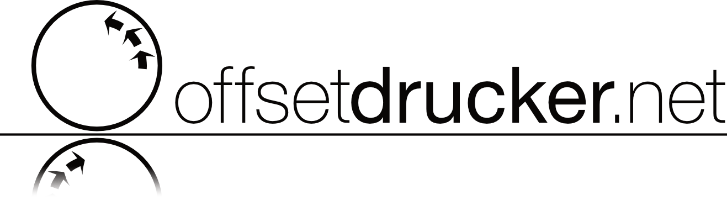Was bedeutet in der Reproduktions- und Drucktechnik optische Dichte?
meine Antwort:
Spoiler anzeigen
Die industrielle Reproduktionstechnik hat lange Zeit fotografische Mittel, Schwarz-Weiß-Filme, benutzt. Zur Qualitätsbeschreibung solcher Filme brauchte man ein Maß für Schwärzung, um die Qualität einer Vorlage, eines Filmes, einer Entwickler- oder Belichtertechnik zu beschreiben. Dazu bediente man sich des physikalischen Begriffes Extinktion (Auslöschung) und benannte ihn verständlicher in „optische Dichte“ um. Sie sollte uns ein Maß für die Schwärzung eines Filmes geben. Wenn eine geschwärzte Filmstelle doppelt so viel schluckte (= halb so viel Licht hindurch ließ) wie eine Vergleichsstelle, sollte - wenigstens einigermaßen - auch ein doppelt so hoher Wert für die Dichte herauskommen. Das klappte hinreichend gut mit dieser Extinktion.
Dazu baute man sich „Durchlicht-Densitometer“, also oben eine Lampe und unten ein Lichtmessgerät. Ohne eine Messprobe hatte man eine optische Dichte von Null, mit einem Film dazwischen irgendeinen Wert. Und mit einer Metallplatte fand man kein Licht drunter, also eine unendlich hohe Dichte.
Im Buchdruck und im Offset kann man mit Zonenschrauben die Farbschichtdicke an der Druckmaschine regeln. Aber nicht direkt messen. Also baute man sich ein „Auflicht-Densitometer“ und maß, wie stark farbig das zurückgestrahlte Licht war, also die optische Dichte. Und diesen Wert verglich man mit dem vom Blankopapier. So konnte man die Zonen so einstellen, dass die Farbauftragwalzen eine durchgängig gleichmäßige Farbschicht auf die Platte brachten, egal, wie ungleich die Farbabnahme war.
Die optische Dichte hat keine Einheit, also kein cm, µm oder sec oder andere. Sie ist eine reine Zahl, weil sie aus einem Logarithmus entsteht. Man misst die Lichtströme und berechnet daraus die Dichte des Objektes. Heute gibt es Minicomputer in jedem Messgerät, und so benutzt keiner mehr die Murray-Davies-Formel oder das so genannte Nomogramm.
Manchmal sagt man im, Jargon anstelle optischer auch densitometrische Dichte, um sie deutlich von der (Substanz-) Dichte in g/cm³ abzuheben.