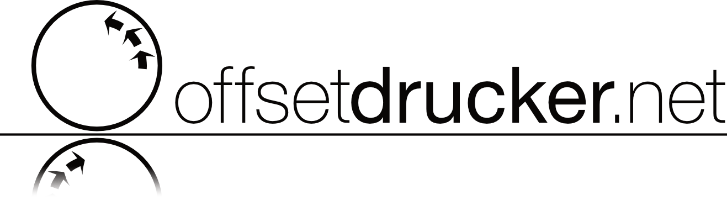Hallo, liebe Forumsteilnehmer,
seit ein paar Wochen bin ich aus gesundheitlichen Gründen gut
ausgebucht und habe mich mit nur wenig anderem beschäftigt. Das
dauert auch noch ein paar Wochen, geht aber vorbei.
Danke, Henrik für diesen interessanten Fall und Cyberfisch für
die nette Einladung mitzumachen. Ich will versuchen, die Sache näher
zu verstehen.
Ob es einen Geister-Mechanismus hat oder übers Ablegen
funktionieren kann, ist mir noch nicht klar. Deshalb, Henrik, habe
ich richtig verstanden?
Die Kartonrückseite wird mit der Schrift und Mattlack
übereinander bedruckt. Dabei ist der Mattlack ein Dispersionslack?
Die Kartonrückseite ist ungestrichen und damit nicht richtig glatt,
die Farb- und Lackschichten also eher dick als dünn?
Beim Druck der Vorderseite laufen die ersten zwei Werke leer mit
Druck, ziehen also den Puder ab. Nach 5000 Bögen hat Gold auf den
ersten, leer gelaufenen Werken und allen folgenden aufgebaut? Ich
vermute mal, dass es mit Lack bedeckte Pigmentteilchen waren. Kann es
ein, dass sie wie andere Aufbauformen den Kontakt der Gummitücher
zur Platte und zum Bogen störten und damit die Farbweitergabe? Waren
sie selbst schwarz eingefärbt? Rasterflächen wären sehr
empfindlich gegenüber solchen lokalen Erhebungen, Volltöne weniger,
weil mehr Material und weniger Punktgrenzen den Kontakt erleichtern.
Dann wäre eine Hypothese: Gold und Lack waren dick gedruckt und
nicht ausreichend verfilmt beim zweiten Durchgang. Das kann
allerdings auch an der Topografie der Rückseite, der
Oberflächenrauigkeit gelegen haben. Oder der Lack hatte eine
Verfilmungsschwäche (gibt es, aber eher selten). Da die braune
Fläche zwei Werke vor dem Schwarzraster läuft, sollten an diesen
Stellen wenigstens feine Aussetzer oder ähnliche Störungen zu
finden sein.
Hat die gelbe Skalenfläche gar keine Defekte, oder liegt da
einfach kein Gold gegenüber?
Wenn es Geister sein sollten, wäre die Vorderseite an den
defekten Stellen z. B. mit kondensierten Oxidationsprodukten
vorbelegt. Dann würde ich auch mindestens minimale Störungen im
Braun erwarten.
Henrik, du hast schon ungewöhnlich viele Einzelinformationen
gegeben und fein beobachtet. Trotzdem ist eine überzeuigende
Hypothese nicht einfach. Sollte es noch einmal vorkommen, bitte
möglichst außer den Druckmustern etwas blanko Karton
(Rauigkeitsmessung, kann die Kartonfabrik) dazu aufheben. Und hier
wäre ein kleines USB-Mikroskop Gold wert, weil man einfach vor Ort
die betroffenen Stellen auf Platte, Gummituch und notfalls beiden
Kartonseiten untersuchen kann. Und man hat Aufnahmen, falls sich mal
etwas wiederholt.
Viele Grüße und habt Geduld mit mir.
Euer Inkman