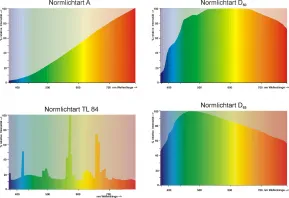Die
Infrarot-Strahlung liegt zwischen dem sichtbaren Licht und der
Wärmestrahlung. Das sagt schon etwas.
Ein
IR-Strahler nach den Druckwerken wärmt nicht gleichförmig den
ganzen Bogen auf, sondern wirkt umso besser, je dunkler die
Druckpartien sind, weil die nicht nur Sichtbares, sondern auch die
Nachbarstrahlung IR am gierigsten aufnehmen.
Durch
die schnelle Erwärmung werden alle physikalischen und chemischen
Vorgänge beschleunigt und teilweise sogar über heftigere
Reaktionswege geführt.
1.
Wegschlagen:
Im
Idealfall (glänzend gestrichenes Papier, Bilderdruck) saugt der
Bedruckstoff aus der Farbe nur den Verdünner heraus, also
Fettsäureester bei den modernen und Mineralöl bei den
traditionellen Farben. Das sind übrigens farblose Flüssigkeiten.
Je
gröber Poren sind, desto ungenauer saugen sie auf, was sie können.
Bei Mattgestrichem und erst recht bei Naturpapier, gehen auch Teile
der Bindemittel mit aus dem Farbfilm - und hinterlassen oft
Festigkeits - Defizite im fertigen Druck. In Zeitungspapier können
ganze Farbtröpfchen in den Löchern verschwinden und fehlen dann
sogar an der Einfärbung. Hier kann die stärkere Verflüssigung
durch Wärme sogar noch mehr schaden.
Die
Farbschicht wird durch das Wegschlagen des Verdünners ganz schnell
halbfest und immerhin berührtrocken. Die modernen Bindemittel
schaffen sogar eine gewisse Filmfestigkeit - noch lange vor einer
oxidativen Verfilmung.
Praktisch
alles, was in den ersten 30 - 60 Minuten geschieht, wird vom
Wegschlagen getragen. Es gibt uns die Stapelsicherheit (Klebarmut)
und Umschlagbarkeit.
2.
oxidative Verfilmung:
Reaktionsfähige,
kettenförmige Moleküle der Pflanzenöle (und -Derivate) haben
Doppelbindungen, die vom Luftsauerstoff angegriffen und geöffnet
werden können. Wenn sie in günstigen Stellungen zueinander liegen,
geben sie sich die Hand wie zwei Ärmchen. Und damit verbinden sie
zwei der kettenförmigen Fettsäureester-Moleküle.
Wenn
das an genügend Stellen passiert, verfestigt sich der
Bindemittelfilm ganz erheblich. Er bringt uns die Festigkeit, die wir
gegen das Wiedererweichen unter Druck (Schneidbalken) und
Scheuerangriffe samt Karboniergefahr brauchen.
Vielleicht
wird hier verständlich, dass diese Verfilmung eine Sache für
Geduldige ist. In der ersten halben Stunde nach Druck gibt es da
praktisch noch keinen messbaren Umsatz. Hauptsächlich passieren
diese Vorgänge am besten über Nacht.
Auch
chemische Vorgänge laufen umso schneller, je wärmer es ist. Dazu
sind sie hier auch noch exotherm, produzieren also eigene Wärme. Und
wenn wir Pech haben, steigt die Stapeltemperatur in den ersten
Stunden nach Druck dadurch so weit an, dass die Farbschichten wieder
klebrig werden - das Nachkleben. Also ist hier das richtige Maß
wichtig, wie auch Johnny85 schreibt.
Ich
habe in Erinnerung, dass in alten Zeiten ein max von 38°c galt
(unlackierte Offsetdrucke). Das kann heute leicht anders sein, weil
die Bindemittel vermutlich deutlich anders geworden sind. Aber
grundsätzlich gilt es wohl.
Gefühlsmäßig
sehe ich bei typischen Quickset-Farben, also Allround-Farben (sog.
IR-reaktive Farben) die Gefahr des Nachklebens geringer als bei den
fetteren Glanz-, Scheuerfest- oder gar Folienfarben. Je mehr
chemische Verfilmung eingebaut ist, desto stärker kann die
Eigenerwärmung durch die Verfilmung sein, klar.
3.
Dispersionslack
In
meinen ersten Jahren in der Branche gab es häufig Reklamationen
wegen Ablegen und Blocken im Stapel. Es gab praktisch keine
Lackierwerke an Maschinen. Eine Lackierung aus dem 5. Werk war selten
eine Erleichterung, eher nur Schutz oder Glanz, weil der Drucklack ja
nix Neues anbot.
Mit
den in-line-Lackierwerken zog die Flexotechnik in die
Offsetdruckereien ein. Und brachte eine technische Revolution.
Warum?
Dispersionslacke
sind völlig anders aufgebaut als Öldrucksysteme. Sie bestehen aus
einem fettigen Bindemittel, das in winzigen Tröpfchen in Wasser
einemulgiert ist - wie eine Milch. Das Wasser kann sehr
schnell in den Bedruckstoff wegschlagen und das reine Bindemittel
übrig lassen. Das passiert praktisch sofort - aus der Maschine -
berührtrocken. Und dazu verfilmt es noch (physikalisch, nicht
chemisch) innerhalb von 10 - 15 Minuten - wieder flott und weitgehend
vollständig. Und schon bringt es sogar Scheuerfestigkeit.
Die
Offsetfarbe unter dem Dispersionslack hat nun Zeit, in Ruhe oxidativ
zu verfilmen. Der Lack schützt nur mechanisch, lässt aber
bereitwillig Luftsauerstoff zur Farbe durch - ideale Kombination. Man
kann sich mit dem Schutz durch Dispersionslack sogar immer weniger
oxidative Verfilmung leisten und mehr Wegschlagen. Das beschleunigt
die Weiterverarbeitbarkeit noch einmal.
Auch
das Wegschlagen von Wasser wird durch die Aufheizung beschleunigt.
Allerdings wird das kaum merkbar sein, weil es ohnehin schnell geht.
Dafür
kommt aber noch ein wichtiger Trick dazu: das Verdunsten des Wassers.
Das wird durch IR natürlich unterstützt, besonders über dunklen
Zonen. Alleine über Erwärmung mittels IR bringt es aber nur
geringen Umsatz.
Auch
mit Dispersionslack muss man die Stapeltemperatur kontrollieren,
damit er nicht blockt. Ich habe max. 28 °C in Erinnerung.
4.
Heißluft
Es
kommt noch etwas hinzu, das die ganze Lage revolutioniert:
Heißluftgebläse. Wenn IR eine Fläche aufgeheizt hat, schwebt
nämlich eine Dampfschicht über der Lackschicht - und hindert
weiteres Wasser daran, aus dem Film herauszutreten. Hier kommt die
Heißluft und schält wie ein Messer die Dampfschicht ab und lässt
neuen Dampf austreten. Kalte Luft würde schon etwas helfen. Aber
warme Luft saugt begierig Feuchtigkeit auf und trägt damit ganz
andere Mengen an Wasser weg.