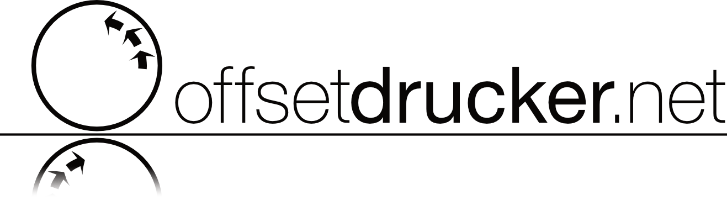Die alten Römer hatten es leicht: Ihnen genügte eine Tontafel, um Informationen an andere weiterzugeben und auch um sie zu konservieren. Sinngemäß war das wie eine Schwarz-Weiß-Welt. Gutenberg und seine Nachfahren kamen auch immer noch mit einer/zwei Farben aus: Schwarz auf Weiß. Da war weder Schwarz definiert - noch Weiß. Es war einfach noch nicht nötig.
Seit wir farbige Darstellungen vervielfältigen wollen, brauchen wir die detaillierten Kenntnisse, was welche Farbe ist, damit der Konsument sie so erkennt, wie der Künstler / Autor es gemeint hat. Ein Profi ist in unserem modernen Verständnis ein Fachmann, der eine Arbeit so herstellt, dass das Ergebnis die technischen Ansprüche erfüllt und wirtschaftlich vertretbar ist.
Bei farbigen Darstellungen gehört die farbliche Wirkung zu den technischen Anforderungen. Und da alles billiger oder teurer geht, müssen wir festlegen können, wie wir "farbliche Ansprüche" meinen.
Wir wissen, dass das weiße Licht am Tage draußen anders ist als im Kaufhaus. Um das zu beschreiben, haben wir bestimmte Lichtarten definiert. Und damit bei den vielen Kollegen und Kunden eine gemeinsame, technische Sprache möglich ist, mussten Lichtarten genormt werden. Dazu haben sich viele schlaue Wissenschaftler und Firmen - Abgesandte in Ausschüssen zusammen gesetzt und klare Beschreibungen verabredet. Das Ergebnis gibt Kreativen und Technikern zahlenweise erfassbare Kriterien. Damit können meist beide umgehen.
Für Tageslicht nimmt man einen "Planckschen Körper", einen theoretischen, innen perfekt schwarzen Kasten, der ein Loch zum Hineinschauen hat. Kalt ist er sehr dunkel. Erwärmen wir ihn, wird er wie das Eisenstück erst Wärme, dann auch sichtbares Licht, später sogar noch mehr herausstrahlen. Diese Lichtstrahlung können wir durch eine Temperatur - hier in ° Kelvin, also absolute Temperatur - charakterisieren. Als wäre das unsere Sonne, denken wir uns so Tageslicht-Simulationen.
Unser sichtbarer Anteil ist der Ausschnitt zwischen Wellenlängen von 380 bis 780 nm. Was außen liegt, geht uns erstmal nichts an.
Der Vorteil eines solchen Modells ist, dass wir damit unser experimentelles Ziel definieren können. Die spannende Frage, wie wir das in der Technik machen, bringe ich im nächsten Beitrag.