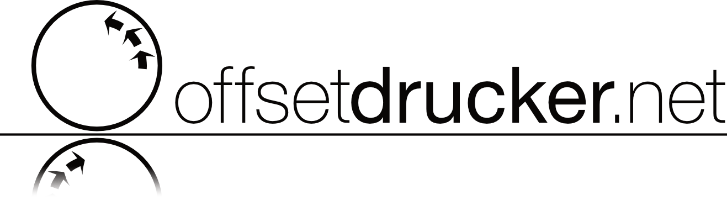Wie stellt man ein Testpanel für Sensorik auf?
Meine Antwort:
Spoiler anzeigen
Wie beim Farbensehen ist auch hier nicht jeder geeignet. Aber Geruchs- und Geschmacks-Beurteilungen können wirklich ernsthaft sein, kein Larifari. Man muss es nur fachmännisch anstellen. Bei allem: Wer sensorisch testen (riechen oder schmecken) lernen will, muss es
1. wirklich wollen
2. ernst nehmen.
Erst einmal muss man entscheiden, ob es ein Panel nur für den internen Gebrauch sein soll, also z. B. zur Orientierung innerhalb der eigenen Technik. Dann sind viele Norm-Bedingungen zu aufwändig. Die Ergebnisse können aber brauchbar sein. Oft genügt der Praxis ein Kompromiss, wenn es nicht um einen Schadensstreit geht, sondern um die Optimierung oder Lenkung einer Produktion.
Oder man will etwas, was nachher offiziell vertreten werden kann. Dann sucht man sich zuerst die aktuelle Norm. Die ist die paar Hundert Euro schon wert. Und dann holt man sich Hilfe von außen.
Raucher und Freunde starker Getränke sind nicht von vorneherein ausgeschlossen. Ich habe in Freising an einem sehr instruktiven Kurs teilgenommen, den eine Raucherin leitete. Und zwar überzeugend. Trotzdem sollten die Testteilnehmer vor dem Test nicht gerade beim Griechen oder Inder essen.
Mitarbeiter aus z. B. dem Drucksaal sollten sich kritisch selbst überprüfen, ob sie den gewohnten Geruch dann im Geschmacksgemisch wirklich wahrnehmen. Das kann durchaus möglich sein. Notfalls kann man das auch selbst überprüfen.
Schmecken geht übrigens nur für wenige Grundgeschmäcker über die Zunge; Tausende andere gehen über den Luftraum mit der Nase. Ein kräftiger Schnupfen bedeutet also vorübergehend Disqualifikation.
Eine sehr professionelle Ausbildung ist z. B. im Fraunhofer-Institut IVV Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising durchführbar. Das ist der schnellste und effektivste Weg, das Thema professionell ins eigene Instrumentarium zu übernehmen. Dazu kommen dann noch recht aufwändige Vorkehrungen in der eigenen Firma oder Behörde. Hier kostet Seriosität Geld - wie bei jeder ernsthaften Analytik. Das lohnt sich nur, wenn routinemäßig solche Untersuchungen gebraucht werden.
Andernfalls sind Analysen bei einem anerkannten Institut kostengünstiger. Beide Wege führen zur Beurteilungssicherheit.