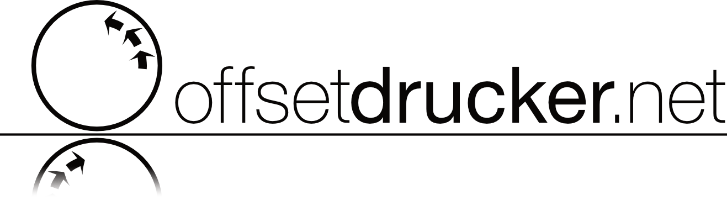1. Lichtechtheit,
Problem: Ausbleichen, manchmal auch Farbton-Änderung, weil das Licht
die Pigmentmoleküle anregt und der Sauerstoff der Luft sie so
angreifen kann. Stufen von 1 = sehr gering bis 8 = hervorragend.
2.
Sprit - Echtheit: Angriff von Ethanol
oder vergälltem Ethanol = Spiritus
Isopropylalkohol ist in den FM - Konzentrationen nicht gefährlich, hier geht es um
nachträgliche Lackierungen und Verklebungen fertiger Drucke
3.
Nitro - Echtheit, Problem: Ausbluten, weil Pigment angelöst wird
Angriff
von speziellem Lösemittelgemisch, bekannt aus der Lackindustrie,
in
DIN ISO 2836 zusammen mit anderen "chemischen" (Substanz-)
Echtheiten
4.
Alkali - Echtheit, Angriff von verdünnter Natronlauge,
Problem:
Ausbluten oder meist Farbtonveränderung wegen chemischer Veränderung
Alle
3 "chemischen" Echtheiten werden in 5 Stufen angegeben:
oder
von 1 = nein bis 5 = ja,
häufig
nur „ja – bedingt – nein“ oder „+ +- -„
Auch
in unserer Welt kann man für Geld nicht alles kaufen. Es gibt ganze
Farbtonbereiche, in denen keine Pigmente zu finden sind, die hohe
Echtheiten aufweisen. Das betrifft z. B. farbtonreine rötliche
Blaus bis Violetts. Die phantastischen Phthalocyanine decken leider
nur die grünere Seite der Blaus ab. Sie widerstehen allem und sind
auch noch kostengünstig.
Bekannt
und berüchtigt sind die Triphenylmethan-Derivate z. B. unter den
Markennamen Reflexblau und Fanal. Natürlich sind nicht die Marken
oder Hersteller schuld, sondern die allgemeingültige Chemie.
Aufgrund ihrer chemischen Struktur sind diese Stoffe nicht so zu
bekommen, dass sie sich nicht über jedes Lösemittel freuen und
begeistert mit in Lösung gehen. Dann bluten sie nämlich aus.
Bei
den Gelbs ist das Problem die Lichtechtheit, bei vielen Rots auch,
wenn man sie verdrucken will.
Unsere
geringe Farbschichtstärke von nur etwa 1 my verlangt eine
Bären-Farbkraft von den kleinen Kriställchen. Deshalb haben viele
andere Farbanwendungen (Anstrichfarben, Textilien...) dieses Problem
nicht so wie wir. Außerdem können manche anderen Anwendungen
Mineralpigmente einsetzen, die grundsätzlich robuster sind als
unsere Vertreter der organischen Chemie