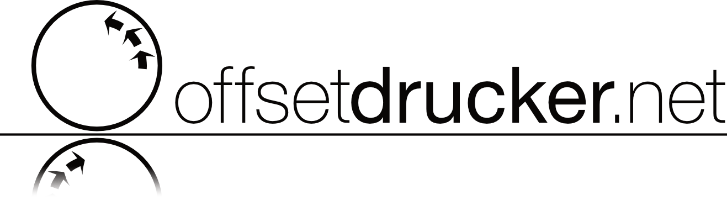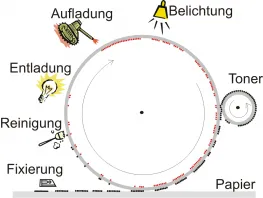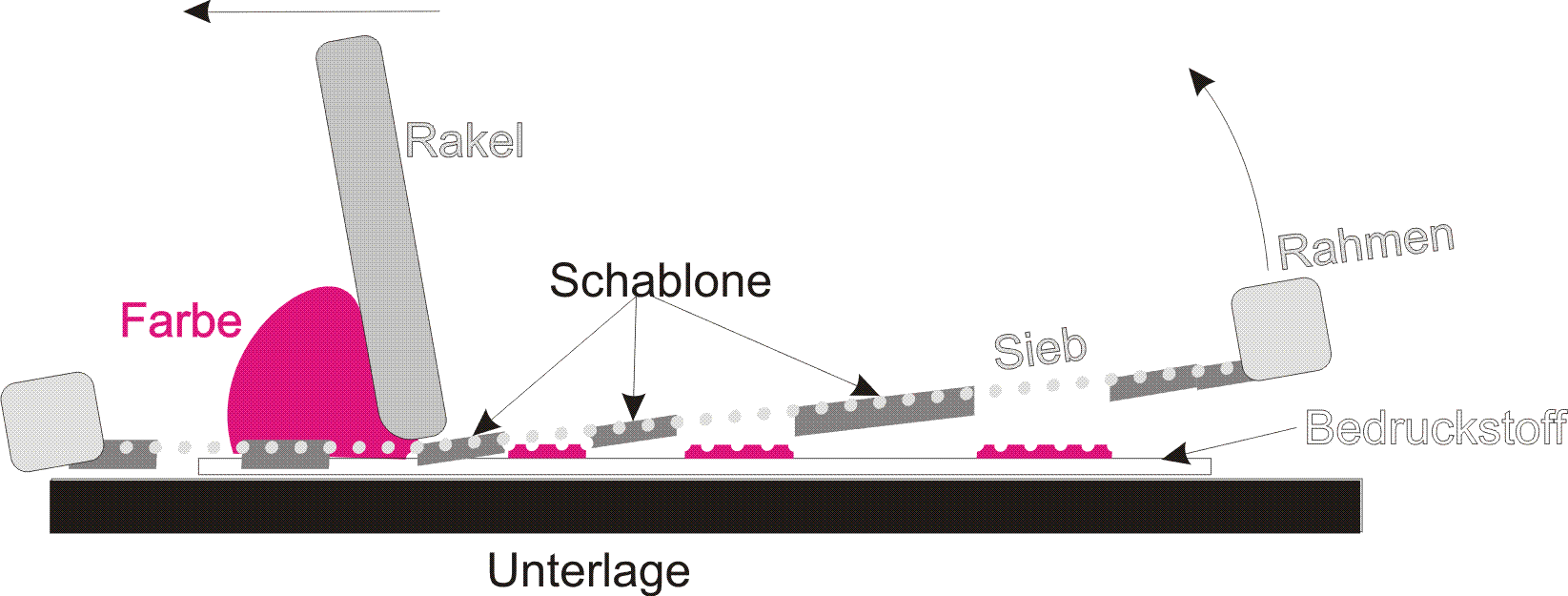Was alles beeinflusst den Farbenraum des Raster-Vierfarbendruckes? Erweiterung zu Frage 53: dort Druckverfahren und Rastertechnik,
meine Antwort:
Spoiler anzeigen
1. Der Bedruckstoff hat eine Eigenfärbung, die immer etwas vom Idealweiß abweicht. Da wir lasierende Skalenfarben verwenden, schaut seine Eigenfärbung durch den Druck hindurch. Seine Topografie, also die Unebenheiten der Oberfläche im Mikrobereich, sorgen für Unruhe in der Farbschichtdicke und bringen damit etwas Verschwärzlichung. Die Porosität (Saugeigenschaften) können ideal sein wie bei glänzend gestrichenem Papier, so dass nur die Farbverdünner abgesaugt werden, keine Bindemittel oder gar färbende Anteile. Es kann wie auf Naturpapier aber auch passieren, dass ganze Farbtröpfchen in Poren verschwinden und somit der Färbung fehlen. Und zuletzt gibt es Oberflächen, die die Farben besser oder schlechter annehmen, sogar bei Offsetfarben.
2. Eine nachträgliche Druckveredelung wie Lackierung oder Folienkaschierung hat wieder eine Menge Einfluss auf den endgültigen Farbton, egal, ob in line oder nass-auf-trocken (Lupeneffekt und Wegfall der Bronze).
3. Die Schwarzfarben der Skala sind je nach Geschmack bunt geschönt, damit sie viel Tiefe zeigen. Besonders in leichten Rasterpartien bringen unterschiedliche Schwarzfarben auch leicht unterschiedliche Farbschimmer ins Bild.
4. Der Siebdruck hat mit seinen hohen Schichtdicken deutlich mehr Deckkraft, was den Einfluss des Bedruckstoffes bremst.
5. Nicht koloristisch begründet, sondern eher technisch in Produktqualität: Besonders unbunte Pastelltöne sind nicht gut flächig aus der Skala im Offset druckbar, z. B. das Hintergrundgrau in Mercedes-Prospekten. Die Tonwerte der Skalenfarben schwanken immer etwas in der Auflage. Und solche Farbflächen zeigen dann überdeutlich, ob einmal das Cyan oder das Magenta schwankt.
6. Die Punktform auch bei periodischen Rastern kann den Lichtfang und damit die Farbwirkung der Rasterflächen beeinflussen. Man vergleiche kompakte Punkte wie Ellipsen mit so stark gegliederten Punktformen wie z. B. Sandy P. Solche speziellen Konstruktionen unterdrücken nicht nur den Punktschluss-Effekt und schaffen damit weichere Verläufe. Sie vergrößern bei einem gegebenen Tonwert auch die Randlinie, geben also mehr Lichtfang-Anteil in der Farbwirkung.
7. Im Nassoffset hat auch die Feuchtungstechnik eine Bedeutung. So kann man mit einem konventionellen Feuchtwerk nur schwer Feinraster drucken, mit einer direkt-indirekt-Feuchtung, z. B. Alcolor, dagegen sind auch filigranere Strukturen und damit mehr Lichtfang umsetzbar. Ganz ohne Feuchtung schafft der wasserlose Offset hier noch eindrucksvollere Ergebnisse.